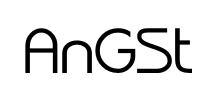Die Angst hat ein Janusgesicht. Einerseits ist sie das „freudige“ Aufgeregtsein und das „drängende Verlangen“ nach etwas oder jemandem. Andererseits ist sie das „beunruhigende“ Aufgeregtsein, das den stets drohenden Tod erahnen lässt. Den frühen Naturvölkern war das Doppelgesicht der Angst noch bekannt. Auch die Maori, deren polynesische Vorfahren vor ungefähr 6‘000 Jahren von Südostasien aus aufbrachen und den pazifischen Raum eroberten, besassen noch das natürlich-ganzheitliche Angstverständnis. Es offenbart sich in ihrer religiösen Vorstellungswelt, ihren kulturellen Ritualen und in ihrer Sprache.
Kapitel: Mana: das göttliche Wirken im Menschen – Utu und Tapu: Rache des göttlichen Erzürnten – Mate: verstörende Gefühle und lebendiger Tod – Mauri, Manawa, Ngakau und Weirua: die Organe der Wahrnehmung – Atua: der Geist der Angst – Angstbewältigung: Kampfdrang und rituelle Reinigung
Mana: das göttliche Wirken im Menschen

Abb. 1) Maori-Paar, Te Puawai O Te Arawa.
Das Wort Maori (Māori) bedeutet „normal“. Der Name für die ersten Bewohner Neuseelands kam auf, als die „Weissen“ auftauchten und in ihren Lebensraum eindrangen. Die Maori haben ihre Mythen und Göttervorstellungen mündlich überliefert, erst die britischen Eindringlinge begangen damit, sie aufzuschreiben. Heute gibt es viele verschiedene Variationen von ihnen. Die „höchste göttliche Kraft“ bewerteten die Maori-Stämme zwar ebenfalls teilweise unterschiedlich, doch sie alle verehrten sie unter dem Namen mana.
Das melanesische Wort mana bedeutet „mächtig“ und „wirksam“. Es umschreibt das Numinose (Göttliche) als eine überpersönliche Kraft, die in Menschen, Tieren, Pflanzen, Gegenständen oder an Orten wirkt. Kein Wunder, definierte das mana daher auch den sozialen Status eines Maori innerhalb seiner Sippe. Ein Mann mit mana zeichnete sich durch Glück und Erfolg aus. Wie stark die göttliche Kraft in ihm wirkte, wurde an den Werten gemessen, welche die Maori am meisten wertschätzten: Mut, Erfolg, Ansehen, Führungsstärke und Gastfreundlichkeit.
Ein Maori erbte sein mana mit der Geburt. Mit Hilfe seiner Stammesangehörigen konnte er es jedoch vergrössern. Vor allem das mana des Häuptlings war sehr eng mit dem seiner Sippe verbunden, da seines dem Glauben nach auch das mana seines Stammes und Landes umfasste. Aus diesem Grund galt das Gruppen-mana für den Anführer als wichtige Kraftquelle. Es liess sein mana grösser und stärker leuchten als das jedes anderen. Verlieren wiederum konnte ein Mann sein mana einerseits dann, wenn sein Stamm im Kampf unterlag. Andererseits verlor er es durch ein persönliches Versagen, zum Beispiel und insbesondere dann, wenn er von atua, dem Geist der Angst, in Besitz genommen wurde.
„Ich bekomme Angst. Und Scham überkommt mich.“
Hinauri, Maori-Mythos
Utu und Tapu: Rache des göttlich Erzürnten

Abb. 2) Stammeshäuptling, Kupferstich von Sydney Parkinson (1784).
Das Gegenstück von mana ist utu, das unter den Maori wohl die grössten Ängste auslöste. Utu bedeutet „rückgängig machen“ und steht für die „Vergeltung“. Wird das mana beleidigt, muss utu die göttliche Ordnung und das Ansehen manas durch eine Rache wieder herstellen. Beschützt wird das mana wiederum von tapu, eine Art Kanon sozialer Regeln. Das polynesische Wort tapu steht sowohl für das Heilige als auch das Verbotene. Übersetzt bedeutet es „das gründlich Gekennzeichnete“ oder auch „das als ausserordentlich Bezeichnete“. Die Maori glaubten, dass die numinose Kraft des tapus eine besondere Behandlung erfordere, konnte es doch verletzt werden und sogar verloren gehen.
Die Maori hatten keine Schrift und dementsprechend kein geschriebenes Recht. Geregelt wurde das Leben durch tapu und noa. Sie beschreiben den Gegensatz zwischen „Göttlichem“ und „Gewöhnlichem“. Solange ein Mann sein tapu aufrechterhielt, verbotene Berge nicht betrat, heilige Fischplätze nicht befischte oder keine „gewöhnliche“ Handlung (noa) ausübte, bevor er eine besondere Arbeit (tapu) erledigte – wie zum Beispiel den Bau eines Kanus –, war ihm auch sein mana wohlgesinnt.
Für die Maori war das Schamgefühl, das sich nach einer Beleidigung einstellte, Angst auslöste und utu herausforderte, das grösste Übel überhaupt. Um in den Augen ihrer Sippe nicht herabgesetzt zu werden und mana zu verlieren, versuchten sie verzweifelt, das tapu nicht zu missachten. Taten sie jedoch etwas Verbotenes oder wurde ihr Stamm im Kampf besiegt, trieb sie die Scham zu ebenso verzweifelten Taten, um sich erneut behaupten und ihr mana wieder vergrössern zu können. Wie in ihren Mythen die Götter, so reagierten auch die Maori auf einen Ehrverlust mit einem Rachefeldzug, Exil, Selbstmord oder anderen gewalttätigen Handlungen.
Mate: verstörende Gefühle und lebendiger Tod

Abb. 3) Horatio Gordon Robley: Maori Woman (1863/64).
Die Verantwortung der Maori galt in erster Linie der Gruppe. Sie glaubten, dass das Individuum nur limitiert Kontrolle über sein Schicksal hätte. Erlebte ein Mann ein Unglück, erklärte er es sich mit Hilfe der göttlichen Naturkraft, die durch ihn wirksam wurde. Der Unberechenbar- und Veränderlichkeit der Natur war er sich jedoch ebenfalls bewusst. Jeder Mann musste daher immer wieder seine soziale Stellung aufs Neue verteidigen und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Versagte ein Maori und verlor sein mana, verlor er auch all seinen Status. War dies der Fall, galt er fortan als mate, als tot und damit als inexistent.
Das Wort mate umschreibt alle Arten der Schwäche, sei es eine Krankheit oder den Hunger. Als mate betitelt wurde auch jemand, der beunruhigende Emotionen durchlebt. Zu diesen zählten vor allem die Angst, die Trauer und die wehmütige Liebe. Ihre Entstehung erklärten sich die Maori mit einem Angriff von aussen. So deutete man auch die Angst als die Attacke eines spirituellen Hüters, der erzürnt worden war und sich am Menschen rächte, indem er in ihm die beklemmenden Gefühle hervorrief.
Nicht aktiv gegen diese verstörenden Emotionen vorzugehen, war für einen Maori genauso unvorstellbar, wie sich nicht für eine Beleidigung zu rächen. Auf die durch göttliche Attacken ausgelösten Gefühle reagierten die Maori mit der Anwendung von Gewalt gegen sich oder andere. Die extremste Form der Selbstgeisslung war der Suizid, der vor allem bei Frauen üblich war, deren Ehemänner verstorben waren. Die Männer bewältigten sie für gewöhnlich, indem sie in den Kampf zogen.
Mauri, Manawa, Ngakau und Wairua: die Organe der Wahrnehmung

Abb. 4) Die Maori definierten sich selbst über die Organe. Die Doppeldeutigkeit der Angst wird insbesondere an ihren „Erfahrungsberichten“ verdeutlicht. Das Bild zeigt einen Janusköpfigen Stein-Mauri, Puketapu (Nord-Taranaki).
Die Maori hatten keinen starken Sinn für Autonomie und Individualität. Was wir heute als das Erleben unseres „Selbst“ bezeichnen, drückten sie als eine Erfahrung der Organe aus. Ihrer Anschauung nach hatten sie nicht die Kontrolle darüber, was mit ihnen geschah, was sie dachten oder taten. Sie waren vielmehr eine Art Beobachter ihrer eigenen wahrnehmbaren Erfahrung, die selbst kein Teil von ihnen war (obwohl sie in ihrem Innersten wirkte), sondern eine von aussen kommende, unbeeinflussbare Kraft.
Das Numinose wirkte ihrer Auffassung nach im Menschen mit Hilfe spezieller Organe. Die in der Forschung bekanntesten sind mauri, manawa, ngakau und wairua. Viele dieser Wahrnehmungsorgane wurden zwar mit einem Teil der Anatomie in Verbindung gebracht, sie sind jedoch nicht mit irgendeinem Körperorgan gleichzusetzen. Das manawa beispielsweise wurde mit dem Atmen assoziiert. Seinen Beschreibungen ist jedoch nicht zu entnehmen, ob die Maori das Herz, den Magen oder die Lunge als Sitz des Atmens betrachtet haben. Dass die Wahrnehmungsorgane gut funktionierten und im natürlichen Gleichgewicht waren, deutete man mit den Aussprüchen „grosses manawa“ oder „grosses ngakau“ haben an.
Die Organe besassen immer mehrere Eigenschaften, die sprachlich umschrieben wurden. Derselbe Ausdruck konnte also für mehrere Wahrnehmungen stehen. Das mauri beispielsweise benannte die „Lebenskraft“, „Lebensessenz“ und ein „Lebensprinzip“. „Das mauri gibt einen Ruck“ konnte „Angst“, „Erregung“ oder „freudige Überraschung“ bedeuten, die Bezeichnung „das Pochen des Herzens“ wiederum „Angst“ oder „freudige Aufgeregtheit“.
Das manawa (Ausdauer, Durchhaltevermögen, Beständigkeit) wurde mit der Atemfunktion gleichgesetzt. Das beständige Atmen war für die Maori ein Zeichen von Mut. Ein „grosses manawa haben“ bedeutet „geduldig“, „mutig zu sein“ oder „bleibende Kraft zu haben“. Ein „geschlossenes manawa haben“ umschreibt wiederum Gefühle der Unlust, Depression oder des Nervösseins. Ein „zitternd aufgeregtes manawa“ wiederum bedeutet „unruhig“ und „ängstlich“ aber auch „glücklich bewegt“.
Das ngakau wird in der Forschung oft als Sitz des Verstandes bezeichnet, es stellt jedoch vielmehr eine Einheit von Erkenntnis, Gefühl und Wille dar. Die Erfahrungen von ngakau (Verlangen, Drang etwas zu tun) sind wie im Fall des manawa ebenfalls sprachlich doppeldeutig. Beispielsweise kann es „gut fühlen“, „lachen“, „befriedigt sein“ und „fröhlich“ heissen, aber auch „Schmerz empfinden“, „schwach sein“ oder „dunkel“. Dass die Angst trotz mancher negativen Assoziation als Beschützerin des Menschen betrachtet wurde, zeigt sich am Ausdruck ein „grosses ngakau haben“. Er steht nämlich nicht nur für das Funktionieren der Organe, sondern bedeutet auch „ängstlich zu sein, etwas zu tun“, während „ohne ngakau zu sein“ heisst, „ohne Verlangen für etwas oder jemanden zu sein“.
Das wairua (Geist, Stimmung, Seele, Tatkraft) stellt einen Spezialfall dar. In den Organbeschreibungen wird es als unabhängig von seinem Wirtskörper beschrieben. Anders als die anderen Organe besteht es nämlich ebenfalls aus einer stofflichen Form, ist es doch mit dem Erscheinungsbild einer Person verbunden und teilt darüber hinaus seine Fähigkeiten, Bedürfnisse oder Neigungen. Ein Maori war davon überzeugt, dass sich sein wairua selbständig bewegen, umhergehen, sehen, gesehen werden und sogar kämpfen konnte.
Atua: der Geist der Angst

Abb. 5) George Pulman: Paora Tuhaere (ca. 1870).
In der Vorstellungswelt der Maori scheinen die Wahrnehmungsorgane mauri und wairua sowie manawa und ngakau miteinander verknüpft gewesen zu sein und eine eigene kleine Auswahl an Wahrnehmungen besessen zu haben. Sie beschreiben jeweils die eine Hälfte des heute zerrissenen Janusgesichts der Angst: auf der einen Seite manawa und ngakau, die das Verlangen, die Sehnsucht oder Freude umschreiben, auf der anderen Seite die von wairua und mauri beeinflusste Unruhe, das Besorgtsein und das Angstgefühl.
Die Maori betrachteten die Angst als einen Angriff durch atua, das als „Beschützer“ und „Wächter“ des tapu galt. Bei ihm handelt es sich gleichfalls um einen spirituellen Hüter, der Substanz besitzt und unabhängig agiert. Werden die tapu-Regeln missachtet, verärgert man es. Die Anwesenheit atuas kann jedoch nur durch das wairua wahrgenommen werden! Mit dem Ausdruck mana atua wiederum bezeichnet man die Macht, Autorität und Rechte eines Gottes (oder auch mehrerer Götter). Zeigte ein Krieger vor der Schlacht körperliche Anzeichen von Angst, so hiess es, sein Körper sei von einem erzürnten atua besessen worden.
Die Sprache der Maori kennt etliche Ausdrücke und Beschreibungen für die Angst. (Das Maoridictionary führt fast fünfzig Hauptbegriffe und etliche Redewendungen auf). Aus Sicht der Maori stellte die Furcht keine Reaktion auf einen Angstauslöser dar, sondern einen Akt der Ansteckung, der Übertragung. Infiziert wurde man der Vorstellung nach durch das feindselige atua einer anderen, lebendigen oder toten Person. Ein Maori begründete beispielsweise seine Angst vor dem Überqueren eines Platzes, auf dem ein Mann getötet worden war, mit den Worten: „eine Person mag keine körperliche oder persönliche Angst vor dem Platz haben, aber sein wairua wird sich vor dem wairua des Toten fürchten, daher beeinflusst die Angst den Mann durch sein wairua.“
Die Angst in Form des atua wurde als ein Omen gedeutet und als die Warnung eines Teils der Naturkraft, die im Menschen wirkt und ihn zu beschützen versucht. Das wairua wiederum war dafür verantwortlich, mögliche Gefahren wahrzunehmen und zu enttarnen. Ein Maori erklärte den Zusammenhang folgendermassen: „Fängt nachts auf der Reise ein Maori zu singen an, ist das ein böses Omen … das wairua des Singenden, das ihn schützt, hat irgendein Unglück bemerkt oder ein Unheil, das sich seinem Körper nähert. Der Sänger weiss nichts von der ihm vorbestehenden Schwierigkeit, er kann sie nicht erkennen, aber sein wairua weiss alles über sie, und deshalb drängt es ihn nachts zu singen.“
Angstbewältigung: Kampfdrang und rituelle Reinigung

Abb. 6) Ein Rangatira (Stammeshäuptling), Gravur von Sydney C. Parkinson (18. Jahrhundert).
Die Maori waren ein sehr kriegerisches Volk, und die Beziehungen zwischen den Familien und den unterschiedlichen Stämmen waren sehr komplex. Die Mitglieder einer Gruppe kämpften zwar gemeinsam gegen Feinde von aussen. Doch auch innerhalb der Sippe und sogar innerhalb der Verwandtschaft herrschten im Allgemeinen Eifersucht und Konkurrenzdenken vor. Nur ein Mann hoher Geburt konnte dem Glauben nach, sein ganzes Potenzial entfalten. Die Männer mit niederem Status wurden für gewöhnlich herabgesetzt und als ängstlich, ignorant, leichtsinnig, dumm oder reizbar betitelt. Kein Wunder, waren Scharmützel unter den allermeisten Stämmen an der Tagesordnung. Unterlag ein Stamm dem anderen, bedeutete dies für die Unterworfenen Sklaverei und Folter oder aber Tod und „Gefressen werden“, betrieben die Maori doch rituellen Kannibalismus.
Die Kämpfe, die zumeist im Sommer ausgetragen wurden, dienten dazu, das mana der eigenen Sippe zu vergrössern. Der Preis dafür war sehr hoch. Die vom Vergeltungsdrang beseelten Kämpfe entfachten nämlich immer eine Spirale der Angst und Gewalt. Die Rache, das utu, musste schliesslich immer extremer ausfallen als die Beleidigung, so verlangte es tapu. Seinetwegen hätten sich die Maori fast selbst ausgerottet.
Die göttliche Naturkraft galt als nicht beeinflussbar, die Wahrnehmungsorgane hingegen schon. Sie konnten ihrer Vorstellung nach rituell manipuliert werden. Verschiedene Rituale halfen dem Maori beispielsweise bei der Vorbereitung zum Kampf. Schliesslich war es sehr wichtig, dass sein ngakau seiner Natur entsprechend funktionierte, bevor er in den Krieg zog. Viele Zaubersprüche wiederum, die dem wairua des Gegners galten, sollten das ngakau des Feindes in Angst versetzen.
Fürchtete sich ein Mann vor einem Kampf, galt das als schlechtes Omen und hinreichender Grund für ihn, nicht zu kämpfen. Doch der Maori, für den die Scham das Schlimmste war und der sich immer aktiv gegen seine verstörenden Gefühle zur Wehr setzte, versuchte natürlich auch, seine Angst durch Rituale zu beseitigen. Eine Methode zur Befreiung von atua war, unter den Beinen einer hochgeborenen, sozial überlegeneren Frau hindurchzukriechen, wurde den weiblichen Geschlechtsorganen (natürlich besonders der Vagina) atua-befreiende Kräfte nachgesagt. Zeigte ein Mann nach dem Ritual keine Angstzeichen mehr, galt er als befreit und kampfesbereit. Wies er jedoch noch Anzeichen auf, betrachtete man die rituelle Reinigung als fehlgeschlagen. Er wurde vom Kampfeinsatz freigesprochen und durfte nach Hause gehen. Von nun an war er aber mate und somit ein umherwandelnder Toter, der ohne mana war und von atua beherrscht wurde.
Das Janusgesicht der Angst war den Maori noch bekannt. Andere Naturvölker (wie auch die Fore, die im Beitrag „Die Gesichter der Angst“ Erwähnung finden) unterschieden ebenfalls nicht zwischen einem „beunruhigenden“ und einem „freudigen“ Aufgeregtsein. Erst der Kulturmensch hat in seiner Differenzierungs- und Katalogisierungswut Verzicht- und Gefahrenangst getrennt. Obwohl die moderne Neurowissenschaft die Doppelfunktion der Angst sogar empirisch nachweisen konnte, wird das heutige Angstverständnis noch immer ausschliesslich durch ihren „beunruhigenden“ Teil dominiert. Eine Aufklärungsarbeit ist auch gar nicht erwünscht. Das wairua könnte sich schliesslich bewusstwerden, dass atua den Menschen aus guten Gründen in Erregung versetzt.
Zitate: Smith, Jean: Self and Experience in Maori Culture, in: Indigenous Psychologies: The Anthropology of the Self, hg. v. Paul Heelas und Andrew Lock, London u.a. 1981, S. 145-159; Maoridictionary.co.nz.
Literaturverzeichnis: Allen, Anne E. (Hg.): Repositioning Pacific Arts. Artists, Objects, Historics, Sean Kingston 2014; Best, Elsdon: Spriritual Concepts of the Maori, Wellington 1900; Ders.: The Maori, 2 Vols. Wellington 1924; Frank, Thomas Sebastian: Mythen der Maori. Legenden von Neuseelands ersten Menschen, neu erzählt nach authentischen Quellen, Wien 1996; Goldie, Terry: Fear and Temptation. The Image of the Indigene in Canadian, Austalian, and New Zealand Literatures, Kingston/Montreal/London 1989; King, Michael: Maori. A Photographic and Social History, Auckland 1984; Kittelmann, Udo und Schmitz, Britta (Hg.): Gottfried Lindauer. Die Māori-Portraits. Für die ‚For the‘ Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, in Zusammenarbeit mit der ‚in collaboration with‘ Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, Köln 2014; Lewis, David: Die Maori. Die Erben Tanes, Luzern und Herrsching 1988; Museum Volkenkunde: The Power of New-Zealand’s first Inhabitants, Leiden 2010; Majid, Nadia: My Mother was the Earth. My Father was the Sky. Myth and Memory in Maori. Novels in English, Oxford u.a. 2010; Pahud de Mortanges, René: Die Archetypik der Gotteslästerung als Beispiel für das Wirken Archetypischer Vorstellungen im Rechtsdenken, Freiburg 1987; Prytz-Johansen, Jørgen: The Maori and his Religion in its Non-Ritualistic Aspects, Copenhagen 1954; Salmond, Anne: Between Worlds. Early Exchanges Between Maori and Europeans 1773-1815, Honolulu 1997; Smith, Jean: Self and Experience in Maori Culture, in: Indigenous Psychologies: The Anthropology of the Self, hg. v. Paul Heelas und Andrew Lock, London u.a. 1981, S. 145-159; White, John: Ancient History of the Maoris, 6 Vols. Wellington 1887-1890.
Bildernachweis: Titelbild, 2, 3, 5) Kittelmann, Udo und Schmitz, Britta (Hg.): Gottfried Lindauer. Die Māori-Portraits. Für die ‚For the‘ Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, in Zusammenarbeit mit der ‚in collaboration with‘ Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, Köln 2014; Abb. 1, 4) Lewis, David: Die Maori. Die Erben Tanes, Luzern und Herrsching 1988; Abb. 6) Salmond, Anne: Between Worlds. Early Exchanges Between Maori and Europeans 1773-1815, Honolulu 1997.